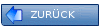Beiträge: 0
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
20 gesamt
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
20 gesamt
Hauptforum
Paranormal Deutschland
e.V.
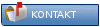
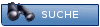
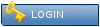
Hauptforum Heilerforum Hexenforum Jenseitsforum Literaturforum OBE-Forum Traumforum Wissensforum Nexus Vereinsforum ParaWiki Chat
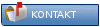
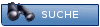
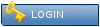
(BETA) Links zu Beiträgen, Artikeln, Ressorts und Webseiten, die zu diesem Beitrag passen könnten (Alle bisher vermerkten Stichwörter und URLs):
Handlesen: Die Kunst des Handlesens (*)
und der 2te nebu...
mOrPhEuS schrieb am 6. Oktober 2001 um 12:30 Uhr (733x gelesen):
NEBUKADNEZAR II. (zur Namensform und -deutung vgl. Nebukadnezar I.), König von Babylon 604-562, war der erste Sohn Nabopolassars (babylonisch: Nabû-apla-ußur = Gott Nabû, schütze den Sohn!), ebenfalls König von Babylon 625-605 und Begründer des spätbabylonischen Reiches. Nebukadnezar, dessen Namensgebung offenbar programmatisch an dem großen Vorfahren Nebukadnezar I. orientiert war, hatte einen jüngeren Bruder mit Namen Nabium-schumam!-lischir (Gott Nabû, der Name = Nachkommenschaft möge gedeihen!). Ein weiterer Bruder hieß Nabû-zera-uschabschi (der Gott Nabû hat Samen = Nachkommen entstehen lassen). Früh beteiligte der Vater seinen Sohn Nebukadnezar bei öffentlichen politischen Aufgaben. Beim Bau des Etemen'anki, des Terrassenhoch-Tempels in Babylon, durfte Nebukadnezar mit den Bautrupps Lehm, Mischwein, Öl und Holzscheite tragen, während der Vater selbst mit gerafftem Königsgewand Ziegel und Lehm auf dem Kopf transportierte. Bei derselben Gelegenheit machte Nabopolassar den jüngeren Sohn Nabiumschumamlischir mit auferlegtem Erd-Korb aus Gold und Silber zum Tempel-Oblaten für den Gott des Tempels und der Stadt: für Marduk. Seit dem Frühjahr 607 zog der alternde und kränkelnde (so Berossos bei Josephus, Antiquitates X,11,1; Contra Apionen I,19,4) Nabopolassar seinen Ältesten mehr und mehr zu den Regierungsgeschäften heran, nachdem er schon vorher militärische Unternehmungen mit ihm gemeinsam durchgeführt hatte. Zwei Jahre später 605 übertrug er ihm den Oberbefehl über die gesamten Truppen und beauftragte ihn mit der Eroberung der Stadt Karkemisch am Euphrat (vgl. Jer 46,2, 25,1: 4. Jahr Jehojakims; 2 Chron 35,20 f.). Dort hatten die Ägypter erfolgreich eine Garnison unterhalten. Diese Aufgabe erledigte er mit starkem Engagement und großer Härte. Die Flüchtenden verfolgte er bis Hamath und ließ sie niedermachen. Sein Sieg hatte zur Folge, daß fast ganz Syrien und Palästina vom Euphrat bis zur Grenze Ägyptens ihm widerstandslos in die Hände fiel. Wenige Wochen später erfuhr er, daß sein Vater am 15. August in Babylon verstorben war. Nach Berossos (bei Josephus, Antiquitates X,11,1; Contra Apionem I,19,5) ordnete er die politischen Angelegenheiten, »bestimmte Näheres über die jüdischen, phönizischen, syrischen und ägyptischen Gefangenen, befahl einigen seiner Freunde mit den Schwerbewaffneten und dem Troß nach Babylonien zu marschieren, während er selbst mit nur kleinem Gefolge durch die Wüste nach Babylon aufbrach.« Unter Eilmärschen traf er dort ein und wurde am 7. September 605 als neuer König anerkannt. Noch im Herbst dieses Jahres setzte Nebukadnezar seinen Syrienfeldzug fort, der bis zum folgenden Februar dauerte. Ohne auf ernstlichen Widerstand zu treffen (vgl. 2 Kön 24,7), zog er umher und kehrte mit reicher Beute nach Babylon zurück. Wohl im selben Jahr wurde auch Eljakim, einer der Söhne des religiösen Reform-Königs Josia, den der ägyptische König Necho (II., nj k'w, nekao = dem Erhabenheit eignet) 608 anstelle seines Bruders Jehoachaz unter dem neuen Namen Jehojakim zum König in Jeusalem eingesetzt hatte, nun Nebukadnezar untertan (vgl. 2 Kön 24,1 ). Nebukadnezar belagerte und plünderte auf dem Feldzug im Jahr 604 die Philisterstadt Askalon (vgl. Jer 47,5), die zum Brückenkopf für Ägypten hätte werden können. Ein in Ägypten gefundener aramäischer Brief bat vergeblich den Pharao um Hilfe vor den Babyloniern. Im Kampf um Askalon wahrscheinlich zeichnete sich ein Grieche mit Namen Antimenidas, ein Bruder des Dichters Alkaios von Mytilene auf Lesbos, als Fremdenlegionär aus, indem er eine kritische Situation durch die Tötung eines ägyptischen riesenwüchsigen (ca. 2,45 m) königlichen Kämpfers rettete. Zwei Jahre später fiel Jehojakim wieder von Nebukadnezar ab und geriet unter den Druck babylonischer, aramäischer, moabitischer und ammonitischer Streifscharen (vgl. 2 Kön 24,1 ). 601 holte Nebukadnezar zum erneuten Schlag gegen Ägypten aus. Nach schweren Verlusten auf beiden Seiten jedoch zog sich Nebukadnezar zurück. Zwei Jahre benötigte er, um sein Heer wieder auf den alten Stand zu bringen. Dies galt insbesondere für die Streitwagentruppe und die Reiterei. Ende 599 erneuerte er seine Syrienfeldzüge. Er sandte Truppen-Abteilungen gegen die Beduinen aus, die sich den Ägyptern untergeordnet hatten (vgl. Jer 49,28-33). Zugleich vernichtete er das Königtum von Hazor (Jer ebd.). Nach den Chronikbüchern (II,36,6-8; Dan 5,2, vgl.1,1; LXX: I Esdr 1,38 f.; Josephus, Antiquitates X,6,2) wäre Johojakim im Frühjahr 597 von Nebukadnezar zur Rechenschaft gezogen worden und, unter Mitnahme von Tempelgräten zugunsten des Marduk-Tempels, in Fesseln nach Babylon deportiert worden, wo er im Gegensatz zum Bericht der Königsbücher (II,24,6; LXX: IV Reg 24,6 // II Prlp 36,8!) dann erst gestorben sei. Josephus (l.c.) redet von seiner Tötung samt den besten jungen Männern direkt in Jerusalem. In diesem Zusammenhang sind auch die Angaben des Danielbuches über die deportierten jüdischen Jugendlichen zu sehen. Allerdings trifft die Jahreszahl (Dan 1,1) vom 3. Jahr Jehojakims chronologisch gegenüber den Chronik- und Königsbüchern (2 Chron 36,6 ff.; 2 Kön 24,1 f.) nicht zu und wird auf eine Zahlenentstellung (Quadratschrift: 'j >>g = 3 statt 11, Datierungkriterium!) zurückgehen, soweit ursprünglich zutreffende Informationen zugrundelagen und nicht die 3 Jahre von 2 Kön 24,1 dahinter stehen. Josephus (Antiquitates X,10,1) zählt Daniel sogar zu den Deportierten aus der Zeit Zedekias (vgl. im folgenden). Nach dem Danielbuch gehörten weiterhin zu den Deportierten Mitglieder aus der eigenen Familie Jehojakims und aus Familien der Vornehmen, mit Kindern, darunter Daniel und seine drei Gefährten. Von diesen ist tatsächlich inzwischen einer mit dem ihm gewohnheitsgemäß neu gegebenen babylonischen Namen, der wie die anderen im Danielbuch tradierten neuen Namen seiner Gefährten entgegen früheren Annahmen sprachlich zutrifft, in einer babylonischen Quelle nachzuweisen. Nicht zuletzt dadurch erhalten die in der Regel kritisch beurteilten historischen Angaben des Danielbuches mehr Gewicht. Auch die ausführenden Aktivitäten des »Oberkochs Ari(w)ukku« (hurritischer Name, biblisch: Arjoch, Dan 2,14) entsprechen historischem Realismus (vgl. im folgenden), ebenso die des »Kochs« (Dan 1,3; »persisch«: aschpaz = Suppenkoch, vgl. noch modernes asch = Suppe, paz Präsensstamm zu pochtan = kochen, biblisch: aschpenaz, mit masoretisch hilfsweise vokalisierter, Nasalierung wie bei Aschkenaz; Datierungskriterium!), der zugleich auch Ober-Leibgardist war. Nach seinem Eigennamen Abicezri (nur LXX: mein Vater = Gott ist meine Hilfe, sofern nicht nur entstelltes aschpenaz, Dan 1,3.11) ist er selbst Westsemit oder gar Jude. Jehojakims Sohn und Nachfolger Jehojachin, zeigte sich gleich nach seinem Regierungsantritt Nebukadnezar trotz der Prophetie Jeremias (27,9-11; vgl. Josephus, Antiquitates X,7,1) nicht unterwürfig. Kaum 3 Monate danach ließ ihn Nebukadnezar in Jerusalem belagern, und zwang die Stadt am 16. März 597 zur Übergabe. 3023 jüdische Zivilisten (vgl. Jer 52,28), darunter der König Jehojachin mit seiner Mutter Nehuschta, der Tochter Elnatans, ferner seine Frauen sowie seine Leibgardisten und höhergestellte Persönlichkeiten des Landes, zusätzlich das Militär: 7000 Mann (vgl. 2 Kön 24,14 f.; 2 Chron 35,17 ff.), einschließlich 1000 Schmiede und Schlosser (vgl. 2 Kön 24,14.16 sowie Jer 24,1; 29,2; Ez 17,12), alles kriegstüchtige Männer, insgesamt rund 10000 Menschen gingen in die Gefangenschaft. Zu diesen Gefangenen zählte auch der Prophet und Priestersohn Ezechiel, der in die Nähe vom Til-Abubi ( = Flut-Trümmerhügel; biblisch u.a. mit u/ü/i-Wechsel: Tel Aviv, Ez 3,15; dort gab es auch eine Stadt) an den Kabar-Kanal (biblisch mit aramäischer Vortonkürzung: Kebhar; Ez 1,1 etc.: Kanal von Sippar über Babylon nach Uruk) verschlagen wurde. Nach dem Esther-Buch gehörten zu den Verschleppten auch die Vorfahren Esthers und ihres Pflege-Vaters Mordechai (Esth 2,6 f.), die nach Susa gelangten. Die rabbinische Literatur (Lev r 19,6; Pes Rab 26,129) weiß wohl mehr spekulativ zu berichten, daß Nebukadnezar Jehojachin während seiner langen Gefängniszeit (bis 561) mit einer neuen Frau aus
TEXdes Überkommenen. Einen Eindruck von der Befindlichkeit jüdischer Deportierter in Babylon vermittelt Ps 137. Am Nebenkanal-System mit den von Nebukadnezar gepflanzten Euphrat-Pappeln sitzen sie inmitten Babylons und haben ihre Leiern an den Bäumen aufgehängt. In der protzigen Weltstadt und ihrer typischen Wohlstandsdekadenz dürfen sie sich verhältnismäßig frei bewegen. Ihre babylonischen Deportierer äußerten aufgrund ihres Polytheismus sogar Interesse am jüdischen Tempelgesang, darin unterstützt von traurigen Deportierten, denen Heimweh nach dem im Vergleich zu Babylon provinziellen Jerusalem immer wieder Tränen in die Augen trieb. Aber strenge Frömmigkeit verbietet den Musikanten solchen Gesang zur falschen Zeit am falschen Ort als Blasphemie. Die Gedanken schlagen vielmehr um in den Treueschwur gegenüber Jerusalem und in Glücksgefühls-Hoffnung über Unrechtsheimzahlung. - Das Bild Nebukadnezars in der Nachwelt war mit dem Schwinden der Originalquellen bald nur noch geprägt durch die Erzählung des Danielbuches über den Wahnsinn Nebukadnezars und den Bericht von der Eroberung Jerusalems. Insbesondere die grausame Exekution Zedekias und die Tötung seiner Söhne vor seinen Augen, damit dies die letzte optische Wahrnehmung nach seiner Erblindung bis zum Tode blieb, vermitteln das Bild sadistischer Grausamkeit. Doch unterscheidet sich Nebukadnezar in der bewußtseinsgespaltenen Behandlung von Gegnern und Freunden nicht weniger als es heute, wenn auch unkriegerisch, im sozialen Bereich noch üblich ist. Auch die mafiose militärische Erpressung und die Unterwerfung des Schwächeren durch den Stärkeren mit Gewaltdrohung und bei Weigerung unter durchtriebener Gewaltanwendung, um an seinen Erwerb zu kommen, gehört, mehr oder weniger gesellschaftlich sublimiert, noch immer zur täglichen Wirklichkeit. Die Härte Nebukadnezars gegen Zededia unterscheidet sich von dem Verhalten gegen dessen Vorgänger aus dem speziellen Grunde, daß er Zedekia nach den schlechten Erfahrungen mit den Vorgängern einen Gotteseid abverlangt hatte. Der Bruch dieses Eides wurde in einer Gerichtsverhandlung (Jer 39,5 // 52,9 // 2 Kön 25,6; Josephus, Antiquitates X,8,2), in der auch Zedekia zu Wort kam, zweifelsfrei gemacht. Erst danach erfolgte die Exekution, wie sie in den Gotteseiden vorgesehen war und mit Zusammenpressen der Kehle von der eigenen rechten Hand durch den Vertragspartner bei Vertragsschluß angesichts des zerstückelten Opfertieres selbst sympathetisch vorgesprochen werden mußte. Somit konnte sich Nebukadnezar als Vollstrecker einer Gottesstrafe sehen. In der Brutalität seiner Frömmigkeit unterscheidet er sich nicht von der Psalmen-Frömmigkeit, die die Freude am Untergang der »Bösen« selbst sehr gut kennt (vgl. etwa Ps 137: Kinder-Zerschmetterung). Auf der anderen Seite wußte Josephus (s.o.) zu berichten, daß Nebukadnezar Zedekia, ähnlich wie es Amasis mit seinem Gegner tat, nach seinem Tode mit großer Pracht bestatten ließ. In der rabbinischen Literatur (s.o) war, in der Tendenz sicher richtig, die Beschaffung einer Frau für den gefangenen Jehojachin geltend gemacht. Die Gebete am Schluß der Inschriften Nebukadnezars stehen, abgesehen vom Polytheismus, den biblischen Psalmen im positiven Sinne nichts nach. Die Bitte um gottgefällige Worte z.B. ist nicht Kennzeichen oberflächlicher Religiosität. Von praktizierter Frömmigkeit gibt ein Brief Nebukadnezars Zeugnis, in dem er ausdrücklich bittet, daß alle Vorkehrungen getroffen sein mögen, wenn er erscheine, um sein Gebet zu den Göttern anläßlich der Grundsteinlegung des Tempels Eanna in Uruk zu verrichten. Auch als Psalmendichter hat sich Nebukadnezar selbst betätigt. Von ihm ist ein dekadischer Akrostichos (vgl. Ps 119, oktadisch), der die metrische Struktur des Psalms durch Querstriche anzeigt und deshalb für die Fragen der Metrik besonders wichtig ist, auf den Gottesnamen Nabû erhalten. Den Grund für diese Hilfs-Kennzeichnung wird man wohl in der fehlenden Dichter-Routine sehen können. Nicht nur religiös war Nebukadnezar bescheiden, sondern auch als Herrscher. Bei dem Bau der Zedern-Transportwege im Libanon legte er mit Hand an, wie es sein Vater Nabopolassar ihm vorgelebt hatte. Er trug zwar nicht, wie die übrigen Mannschaften, den großen Erdkorb, sondern nur die weniger strapaziöse Transportkiste. Nach Josephus (Antiquitates X,11,1; Contra Apionen XIX,9) war Nebukadnezar mit einer Mederin verheiratet, Euseb zufolge und in griechischer Namenslautung mit dem Namen Amytis (und Varr.; persisch: Amud = die Füllige = Schöne; zu d >> t im Auslaut vgl. unten Labynetos). Allerdings liegt bei dem Namen wohl eine Verwechselung mit der medischen Frau des Kyros vor. Herodot (Historiae I,185.188) weist Nebukadnezar, da nicht zuletzt die genannten Bautätigkeiten zu dessen Zeit stattfanden, sogar eine Ägypterin mit Namen Nitokris (Nit-iqrt = die Göttin Ne'ith ist erfolgreich) zu. Ebenso in diesem Fall liegt eine Verwechselung vor, da Nitokris auch die Mutter des letzten babylonischen Königs Nabonid (s.u.) gewesen sein soll, deren Name Adadguppi (wohl assyrisch-aramäische Mischbildung: Adad ist mein Arm = Kraft) inzwischen jedoch bekannt ist. Adadguppi aber war die Frau eines babylonischen Magnaten mit Namen Nabubalassu'iqbi (der Gott Nabû befahl sein Leben), aus deren Ehe Nabuna'id hervorging. Das Danielbuch hat die genealogische Verknüpfung wie bei Herodot (ebd. I,77.188) gewahrt, indem Nebukadnezar Vater des Korregenten und ebenso »letzten babylonischen Königs« Belschar'ußur (Gott Bel = Herr = Marduk, schütze den König! Biblisch: Belschazzar) ist. Josephus (Antiquitates X,11,2) liefert schließlich die noch fehlende Gleichsetzung von Belschar'ußur, dem Sohn Nabuna'ids, mit Nabuna'id selbst ( = Naboandel << NABOANAED, griech. Majuskeln OA = fraktionierte o-Lautschreibung, D<< A, L<< D). Keilschriftlich ist der Name einer Frau Nebukadnezars noch nicht ermittelt. Auch könnten trotz allem eine Mederin und eine Ägypterin seine Frauen gewesen sein. 8 Kinder Nebukadnezars sind jedoch bekannt: 1. der bereits erwähnte Awilmarduk, sein Nachfolger; 2. Kaschschâ (Kosename, hypokoristisch zu kaschschaptu = Zauberin), eine Tochter, die Nergalschar'ußur heiratete, den späteren Usurpator (vgl. auch Berossos bei Josephus, Contra Apionem I,20,5), der Awilmarduk ermordete und die Regierung an sich riß; 3. Eannaschar'ußur (Tempelgott Eanna, schütze den König!); 4. Mardukschum'ußur (Marduk, schütze den Namen = Nachkommenschaft!); 5. Marduknadin'achi (Marduk gibt einen Bruder); 6. Muschezib-Marduk (Marduk ist Retter); 7. Marduknadinschumi (Marduk gibt Namen = Nachkommenschaft) und 8. Nabuna'id (der Gott Nabû sei gepriesen!), den Herodot (Historiae I,74) möglicherweise als Vermittler im Krieg zwischen Lydern und Medern bei der Mondfinsternis von 585 neben dem Syennesis aus Kilikien nennt, sofern er nicht darunter Nebukadnezar versteht, den er wie den letzten babylonischen König Nabuna'id Labynetos (griechischer N/L- und d/t-Wechsel) nennt. Die durch den syntaktischen Parallelismus der Genannten im Kontext erwartbare dynastische Positionsgleichheit von dem kilikischen Syennesis und Labynetos spricht eher für den König Nebukadnezar selbst, zumal Nebukadnezar sonst überhaupt nicht bei Herodot auftritt. Ursache für die falsche Namensgleichheit ist derselbe Namensbeginn: Nabu... , der aber auch in der Namenskürzung innerhalb babylonischer Chroniken (vgl.: Pi = Philippos) einen ihrer denkbaren Auslöser findet. Das Gleiche ist auch Berossos (bei Josephus, Antiquitates X,11,1) unterlaufen, bei dem Nabopolassar und Nebukadnezar denselben Namen tragen: Nabuchodonosor = Nebukadnezar. Den Wahnsinn Nebukadnezars und seine 7-jährige Abwesenheit von Babylon, wie das Danielbuch (Kap.4) schildert, erlauben die außerbiblischen Quellen bisher nicht zu verifizieren. Zwar gibt es inzwischen einen fragmentarischen babylonischen Text, der Nebukadnezar als sehr sensiblen und selbstzweiflerischen Menschen darstellt, aber die im Danielbuches geschilderten Umstände entsprechen eher der Situation seines vierten Nachfolgers Nabonid, von dem eine allerdings 10-jährige Babylon-Abwesenheit bekannt ist. Das in Qumran gefundene Textfragment mit dem Geb
Werke: Dekadischer Akrostichos auf den Gottes-Namen Nabû: vgl. S.A. Strong in: Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 20, 1898, 154-162, und dazu im folgenden auch R. Borger (I) s.v. Strong. Brief: vgl. E. Ebeling, Neubabylonische Briefe aus Uruk, Berlin (1930-) 1934, Nr. 5, sowie wieder im folgenden R.Borger (I) s.v. Ebeling. Auftrags-Inschriften: vgl. Verf., Die neubabylonischen Königsinschriften, Alter Orient und Altes Testament 4/I, Kevelaer - Neukirchen-Vluyn 1973, 147-322, ältere Lit. umfassend; neuere ergänzend R. Borger, Handbuch der Keilschriftliteratur I, Berlin 1967, s.v. Langdon NBK; II, Berlin - New York 1975, dto.; III, ebd., 31. - Ergänzungen in den laufenden Bibliographien von Archiv für Orientforschung und Orientalia s.v.
Lit.: D.J. Wiseman, Nebuchadrezzar and Babylon. The Schweich Lectures of the British Academy 1983, Oxford etc. 1985 (mit Lit.); - Ders. in: Das große Bibellexikon, ed. H. Burkhardt etc., Bd. 2, Wuppertal 1988(3), 1239-1241; - E.J. Bickerman, Nebuchadnezzar and Jerusalem, Proceedings of the American Academy for Jewish Research 46-47, 1979/80, 69 ff.; - M. Dandamayev, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 76, 1986, 141-143 (Rez. zu Wiseman). E. Edel, Amasis und Nebukadnezar II, in: Göttinger Miszellen 29, 1978, 13-20 (dazu Verf. o.c. 6). - Chronologische Texte: A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley, New York 1975, 99-102 (Auszug R.Borger in: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments I, Gütersloh 1982-85, 401-404); - R. Borger, Nebukadnezar II. , in: Pauly-Wissowa, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Supplement Bd. XII, 1970, 890-894 mit Literatur; - Ders. in: Biblisch Historisches Handwörterbuch Bd. 2, H-O, Göttingen 1964, 1296 f.; - Verf., Der Kyros-Zylinder mit dem Zusatzfragment BIN II Nr. 32 und die akkadischen Personennamen im Danielbuch, in: Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Achäologie 64, 1975, 192-234; - B. Hartberger, »An den Wassern von Babylon ... «, Bonner Biblische Beiträge Bd. 63, Frankfurt/M - Bonn, 1986; - F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker III, C, 1 , Leiden 1958; - S.M. Burstein, The Babyloniaca of Berossos, Malibu 1978; - R. Labat, in: Fischer Weltgeschichte. Die Altorientalischen Reiche III. Die erste Hälfte des 1. Jahrtausends, Frankfurt 1967, 98-103; - W. Röllig Nebukadnezar, in: Der kleine Pauly Bd. 4, München 1964, 36; - W. v. Soden in: Propyläen Weltgeschichte, Berlin etc. 1960, 125-127 = Taschenbuch-Ausgabe II,1, Frankfurt/M 1962, dto. Ergänzungen in den laufenden Bibliographien von Archiv für Orientforschung und Orientalia s.v. Zu Babel: R. Koldewey, Das wieder erstehende Babylon, neu herausgegeben von B. Hrouda, Berlin - München 1990; - E. Unger, Babylon, wieder herausgegeben mit Vorbemerkungen von R. Borger, Berlin 1970; - J. Oates, Babylon, Übersetzung aus dem Englischen, Bergisch Gladbach 1983; - P. Eisele, Babylon, Bern - München 1980. - Speziell zur babylonischen Kultur: A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, Revised Edition completed by E. Reiner, Chicago 1977. Vgl. auch R. Borger, Handbuch l.c. III, 1975, 134-155; - Encyclopaedia Judaica 12, Jerusalem 1978-82, 914-918; - E. Kirschbaum ed., Lexikon der christlichen Ikonographie Bd. 3, Sonderausgabe, Rom - Freiburg etc. 1974, 304-307.
Diskussionsverlauf:
- Wer war NEBUCHADNEZZAR? ~ - 03.10.2001 13:11 (5)
- Re: Wer war NEBUCHADNEZZAR? ~ - 06.10.2001 12:27
- und der 2te nebu... ~ - 06.10.2001 12:30
- lol ~ - 03.10.2001 21:14
- Re: Wer war NEBUCHADNEZZAR? ~ - 03.10.2001 16:52
- Re: Wer war NEBUCHADNEZZAR? ~ - 04.10.2001 15:26
- Re: Wer war NEBUCHADNEZZAR? ~ - 06.10.2001 12:27