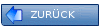Beiträge: 0
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
25 gesamt
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
25 gesamt
Hexenforum
Paranormal Deutschland
e.V.

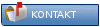
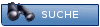
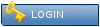
Hauptforum Heilerforum Hexenforum Jenseitsforum Literaturforum OBE-Forum Traumforum Wissensforum Nexus Vereinsforum ParaWiki Chat

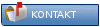
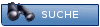
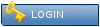
(BETA) Links zu Beiträgen, Artikeln, Ressorts und Webseiten, die zu diesem Beitrag passen könnten (Alle bisher vermerkten Stichwörter und URLs):
Heilen: Reiki (wiki) Hexerei: Hexen-Ressort Magie: Magie-Ressort Magie: Ausbildung zum Zauberer (wiki) Test: Regeln für Experimente (wiki)
Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das?
Anath schrieb am 1. Februar 2004 um 15:17 Uhr (1132x gelesen):
hier zur weiteren Information ein Artikel
Vorsicht, lang ;-)
'Weise Frauen' als Opfer der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen?
Walter Rummel 02.12.2003
Popularität einer These
Wenn die Rede von den Opfern der Hexenverfolgung geht, so trifft man in der Öffentlichkeit am häufigsten die Vorstellung an, es seien die 'weisen Frauen' gewesen, die aufgrund geheimnisvoller Fähigkeiten verfolgt worden seien. Eine bis in das 19. Jahrhundert zurück reichende Tradition ähnlich mystischer Deutungen erfuhr in Deutschland durch das erstmals 1979 erschienene Buch 'Die Vernichtung der weisen Frauen' von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger neue Aktualität. Obwohl die neuere Hexenprozessforschung die Thesen des Buches längst als ahistorisch und seine Methodik als unwissenschaftlich widerlegt hat, ist das darin vermittelte Bild in der Öffentlichkeit noch immer vorherrschend.
Von der Bevölkerungs- und Wirtschaftswissenschaft herkommend, präsentierten die Autoren eine Theorie, welche davon ausgeht, dass kirchliche und weltliche Grund- und Landesherren im Übergang vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit in Zentraleuropa eine bevölkerungspolitische Strategie verfolgt hätten. Ihr Ziel: die durch die Pestzüge des 14. und 15. Jahrhunderts entvölkerten Gebiete möglichst schnell wieder mit Menschen zu füllen. Als Haupthindernis dazu habe man jedoch die Kenntnis empfängnisverhütender Mittel bei den als Hebammen tätigen 'weisen Frauen' angesehen. Deswegen - und nur deswegen - seien sie als Hexen verfolgt worden.
Begriffe
Folgt man den sprachhistorischen Belegen im Grimmschen Wörterbuch, so bezeichnete das Adjektiv 'weise' neben anderen Fähigkeiten schon im späten Mittelalter und im Frühhochdeutschen ein Menschen beiderlei Geschlechts zugesprochenes Potential magischen Könnens, insbesondere die Gabe zur Wahrsagerei. Damit war für zeitgenössische Vertreter der Gelehrtenkultur die Nähe zur strafwürdigen Hexerei beziehungsweise Zauberei durchaus gegeben.
Dass unter 'weisen Frauen' auch Hebammen verstanden wurden, war zwar in der frühen Neuzeit ebenfalls schon partiell verbreitet, meinte aber nicht, dass alle Hebammen potentielle Zauberinnen und Hexen seien. Im 19. Jahrhundert wiederum war die Assoziation von 'weise' mit Magiekompetenz infolge der Aufklärung zumindest im gehobenen Sprachgebrauch verschwunden. Nun wurde 'weise Frau' in der deutschen wie in der französischen Sprache ausschließlich als Synonym für 'Hebamme' benutzt (in letzterer bis heute: sage-femme-), ohne dass dabei die Assoziation verbotener Künste noch mit schwang.
Quellen und Methodik
Als 'zentrale Dokumente' für ihre These führen Heinsohn und Steiger in erster Linie zeitgenössische Traktate an, deren Autoren die Verfolgungen der 'Hexen' befürworteten, insbesondere den berüchtigten 'Malleus Maleficarum' (Hexenhammer). In der gesamten Bearbeitung dieser Texte ist die hervorstechende Methode zum Beweis der Theorie die der Reduktion und Ausblendung. Unberücksichtigt bleibt daher das in den zeitgenössischen Traktakten erwähnte breite Spektrum von Schadenzauberei gegenüber Menschen, Tieren und Ernten. Mit der Behauptung, es handele sich dabei um ältere Vorstellungen, werden diese bei der Argumentation ausgeschlossen. Stattdessen sei es den Traktatautoren vorzugsweise um eine spezielle neue Form der Schadenzauberei gegangen: Impotenzzauber und Kindesmord. Dementsprechend wenden Heinsohn und Steiger auch den klassischen Begriff zur Kennzeichnung der breiten Palette von Schadenzauber - 'maleficium' - reduziert auf solche Zaubereien an, welche der Geburtenkontrolle gedient hätten. Diese Dechiffrierkunst reicht so weit, dass die Figur des Teufels am Ende als 'Verhinderer der Fortpflanzung' definiert wird.
Empirische Überprüfung
Trotz aller Quellenverluste verwahren unsere Archive noch Tausende von Prozeßakten. In ihnen müsste sich, wenn die ‚Weise-Frauen-These' richtig wäre, die besondere Betroffenheit von Hebammen durch die Verfolgungen eindrucksvoll widerspiegeln. Aber auch dies ist nicht der Fall. Vielmehr beschäftigen sich die Prozessquellen, Anklageschriften, Zeugenaussagen und Verhörprotokolle in erdrückendem Ausmaß mit Schadenzauberei, mit ‚unmoralischem' Verhalten der Angeklagten und nicht erklärbaren Vorkommnissen, mit Nachbarschaftsstreitigkeiten und Gerüchten. Die Hebamme als Täterin, die durch ihr Wissen Geburten verhindert und Fehlgeburten erzeugt hätte, existiert lediglich als eine Randfigur des gesamten rekonstruierbaren Opferspektrums, ebenso wie ihr Delikt. Sie ist nicht häufiger vertreten, als es dem Anteil von Hebammen in der frühneuzeitlichen Gesellschaft entsprach, eher sogar noch unterrepräsentiert.
Mangel an Plausibilität, unzutreffende Prämissen
Dass der empirische Quellenbefund die These ebenfalls widerlegt, kann eigentlich nicht überraschen. Denn schon ihre innere Logik erweist sie als ahistorisch und unrealistisch. So würde eine bevölkerungspolitische Strategie der behaupteten Art die Vielfalt der Hexenverfolgungen in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, England, den skandinavischen Ländern und schließlich Neu-England (Salem) unterschiedslos in die Idee eines 'Generalstabsplanes der europäischen Obrigkeiten' (Schwerhoff) pressen. Dem widersprechen die regional völlig verschiedenen Erscheinungsformen der Verfolgungen: Prozessfreie oder prozessarme Zonen wechseln sich mit verfolgungsintensiven Regionen ab, desgleichen die eher längeren Zeiträume ohne größere Verfolgungen mit kurzen Zeiten von hoher Prozesskonzentration. Von einheitlicher Durchführung der Hexenverfolgung also keine Spur!
Selbst wenn Landes- und Grundherren damals geglaubt hätten, durch massenhafte Hinrichtungen von Hebammen ihre Bevölkerungspolitik zu sichern, so ist es völlig ahistorisch anzunehmen, dass der Staat der frühen Neuzeit dazu in der Lage gewesen wäre. Es ist ganz offensichtlich, dass sich die Autoren jener These bei ihrer Formulierung von modernen Staatsvorstellungen haben leiten lassen. Natürlich gab es lokal und regional massenhaft Hinrichtungen, aber nicht nach einem Generalstabsplan oder einheitlichen Muster der beschriebenen Art. Wie sehr die Autoren die Vorgänge in der Frühneuzeit durch die Augen der Moderne sehen, zeigen auch die unsinnigen Vergleiche mit den "Methoden Hitlers und seiner Schergen", deren Anwendung Europa schon "durch die Hexenverfolgung in ein einziges Konzentrationslager" (!) verwandelt habe.
Auch das Kalkül jener "staatsterroristischen Bevölkerungspolitik" (Jerouschek) greift weder für die Kernzeit epidemiebedingter Bevölkerungsverluste im späten Mittelalter noch für die Zeiten der großen Hexenverfolgung. Während es im Spätmittelalter erst zögerlich zu Prozessen kam, ist während der Phasen der massiven Hexenverfolgung eine erhebliche Zunahme der Bevölkerungszahlen zu beobachten. Überbevölkerung nicht Menschenmangel, war das Problem der europäischen Gesellschaften jener Zeit (Behringer). Als ausgesprochen widersinnig erscheint ebenso, dass die zahlreichen Hinrichtungen ihrerseits erhebliche Bevölkerungsverluste verursachten (Jerouschek).
Eine weitere Prämisse für die Richtigkeit der These von der Vernichtung der 'weisen Frauen' wäre, dass das Wissen um die Empfängnisverhütung in der frühen Neuzeit äußerst brisant und geheim gewesen sein müsste. Doch auch dem war in der Realität nicht so, wie neuere Studien (Leibrock-Plehn; Jütte) zeigen. Es gab kein geheimes Verhütungswissen, welches auf generalstabsmäßige Weise hätte ausgerottet werden können. Außerdem bestand im Kirchenrecht und teilweise sogar im weltlichen Recht bis in das 17. Jahrhundert die Neigung, Abtreibungen relativ milde zu sanktionieren (Jerouschek).
Ergebnisse neuerer Forschung
Der These vom obrigkeitlichen Vernichtungsfeldzug gegen die 'weisen Frauen' widerspricht schließlich so ziemlich alles, was die neuere Forschung der letzten 20 Jahre hinsichtlich der Rolle der Bevölkerung bei den Verfolgungen herausgearbeitet hat. Das Ausmaß, in dem Teile der Bevölkerung Verfolgungen gefordert, durchgesetzt und in ihrem Ablauf bis hin zur Opferselektion bestimmt haben, macht es unmöglich, von einer rein obrigkeitlichen Verfolgungsinszenierung zu sprechen. Warum aber sollte die Bevölkerung ihr volksmedizinisches Personal liquidieren? So kann es nicht überraschen, wenn die lokalen Prozessquellen im Grunde keine relevante Häufung von Hebammen als Hexen nachweisen. Denn für die Bevölkerung war weder die 'weise Frau' beziehungsweise die Hebamme noch die Geburtenverhinderung das Problem, sondern der Schadenzauber, den man im Krankwerden und Sterben der Menschen und Tiere reell erlebte. Grundsätzlich brauchte die breite Bevölkerung die 'weisen' Frauen, aber auch die 'weisen' Männer, für ihr Überleben. Natürlich sind Vertreter der Volksmedizin und -magie immer wieder mit ihren Kunden, sei es aus berufsspezifischen Gründen (gescheiterte Therapieversuche), sei es aus allgemeinen Gründen, in Konflikte und in deren Folge auch selbst in Hexenprozesse geraten. Doch hat diese Erscheinung den volkstümlichen Heilerinnen und Heilern keine größeren Anteile als Opfer der Verfolgungen eingetragen als ihr Gruppenanteil an der Bevölkerung, eher sogar noch geringer (Briggs).
Feindbilder und Vorurteile
Womit erklärt sich trotz solcher methodischen Defizite und interpretatorischer Schwächen die weite Verbreitung der Theorie in der Öffentlichkeit? Gerd Schwerhoff hat darauf hingewiesen, dass das diese Variante einer ökonomischen Interpretation das Bedürfnis befriedigt, im Hexenwahn rationale Strukturen entdecken zu können. Doch bedient sie darüber hinaus auch eingeschliffene Vorurteile, romantische Sehnsüchte und vertraute Feindbilder.
So stellt die These von der 'Vernichtung der weisen Frauen' im Grunde eine Verschwörungstheorie dar, welche ältere und neuere Feindbilder miteinander verknüpft. Kirche und Staat fungieren darin als Verfolgungskartell, die Verfolgung der Hexen wird zu einem politischen Schurkenstück. Die Verbindung zur Diskussion um die gegenwärtige Position der katholischen Kirche zur Abtreibung ist offenkundig - man erinnere sich an das Titelblatt, auf dem der "Spiegel" 1988 (Nr. 39) den Memminger Abtreibungsprozess als 'Hexenjagd' bezeichnete. Gleichermaßen offenkundig sind die Anklänge an die in den 70er Jahren von linksradikaler Seite betriebene Agitation gegen das staatliche Gewaltmonopol beziehungsweise gegen das vermeintlich staatsterroristisch-faschistische Gepräge der bundesrepublikanischen Staatsordnung.
Ganz besonders appelliert die ‚Weise-Frauen-Theorie' an eingefahrene Vorurteile gegenüber der autoritären Tradition der katholischen Kirche. Dabei bedarf es solcher Kritik gar nicht, ist doch die historische Verantwortung von Theologie und Kirchen für die Entwicklung und Aufrechterhaltung des gelehrten Hexenglaubens unbestritten. Die zeitgenössischen Kritiker der Hexenverfolgung aus den Reihen der katholischen Kirche konnten ein Lied davon singen, in welchem Ausmaß sie sich entweder bedeckt halten mussten, wie der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635), oder Repressalien erlitten, wie der Theologe Cornelius Loos um 1590 in Trier und später in Brüssel. Es ändert an dieser Verantwortung auch die Tatsache nichts, dass die Verfolgungen überwiegend in den Händen der weltlichen Gerichte lagen. Gleichwohl sind Ansatz, Verlauf und Resultat der Hexenverfolgung völlig anders zu verstehen, als es die Theorie Heinsohns und Steigers vom Verfolgungskartell 'Kirche und Staat' behauptet.
Viel Faszination hat die ‚Weise-Frauen-Theorie' bei Anhängern esoterischer Strömungen und eines romantisch angehauchten Feminismus erzeugt. Damit steht sie allerdings in einer langen Tradition. Denn bereits das 19. Jahrhundert erlebte die Neuentdeckung des Hexenwesens als romantisch-mystisches Erlebnis sehnsüchtiger Bildungsbürger. Als Urheber lässt sich in Deutschland niemand anders als Jacob Grimm aufspüren. Nach gründlichem Studium von vielen Akten und Sagen war der Sprach- und Märchenforscher zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Hexenprozessen Spuren einer vorchristlichen Mythologie zu finden seien. Die 'weisen Frauen', seit den 80er Jahren "Hätschelkinder feministischer Identitätssuche" (Behringer), schon hier traten sie ans Licht, geboren aus der romantischen Sehnsucht nach einer weit zurückliegenden Idylle. Grimms Paradigma fand bei seinem Freund Jules Michelet seine französische Entsprechung: die 'sorcière' als Dienerin des Volkes in praktisch allen seinen Leiden, wovon es erst durch die Revolution erlöst würde.
Die romantische Verklärung der historischen Hexen war Teil der im 19. Jahrhundert entstehenden neuheidnischen Strömung. Als weitere Stationen sind in den 20er Jahren die englische Anthropologin Margarete Murray mit ihrer These vom weiblichen Fruchtbarkeitskult zu nennen. Über die deutsch-österreichische Germanenforschung (Otto Höfler: Wiener Schule) und über den Chef-Ideologen der NSDAP Alfred Rosenberg fand die mystisch-romantische Variante des Hexenthemas auch Eingang bei den Intellektuellen und Pseudo-Intellektuellen des 'Dritten Reiches'. Nun feierte man die 'Hexen' als letzte Gralshüter germanischer Kulte, ja als Träger germanischer Rassesubstanz, die gerade deswegen von der jüdisch unterwanderten Kirche verfolgt worden wären. Publizistisch talentierte SD-Mitarbeiter aus diesen Zeiten haben in der Nachkriegszeit ihren Weg bis in die Redaktion eben jenes Nachrichtenmagazins gefunden, welches 1986 mit seiner Titelgeschichte zum Buch von Heinsohn und Steiger ausdrücken wollte, was man schon immer Böses über 'die Kirche' und nun auch über ihre Komplizenschaft mit einem nicht weniger bösen Staat gewusst habe (Hachmeister).
Grundsätzlich ist differenzierende Wissenschaft immer im Nachteil gegenüber vereinfachenden Theorien. Selbstkritisch muss bemerkt werden, dass die etablierte Wissenschaft in der Vergangenheit durch den Verzicht auf Breitenwirkung und entsprechende Vermittlungsformen viel Terrain aufgegeben bzw. gar nicht erst genutzt hat. Erst in neuerer Zeit ist hier ein Wandel zu beobachten, wie historische Ausstellungen und die wachsende Bedeutung, die man der Geschichtsdidaktik und der Archivpädagogik beimisst, zeigen.
Neuere Forschungen
Die Vermittlung der historischen Realität der Hexenverfolgungen sollte dadurch leichter werden, dass sie ja viel spannender ist, viel näher am Menschen, als eine abgedroschene Verschwörungstheorie, die sich wie ein Plattenbau in einem historischen Freilichtmuseum ausnimmt. Die archivalischen Quellen zu den frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen bestätigen nämlich, dass es sie wirklich gab, jene 'weisen' Frauen, und neben ihnen die 'weisen' Männer. Nur hatte es mit ihrer Rolle im Alltag und in den Hexenverfolgungen eine ganz andere Bewandtnis: Ganz im Sinne des anfänglich referierten begriffsgeschichtlichen Befundes gab es in der frühen Neuzeit in beiden Geschlechtern Personen, die in dem Sinne 'weise' waren, als sie über damals sehr stark nachgefragte volksmedizinisch-magische Kompetenzen verfügten: wichtig nicht allein bei Schwangerschaft und Geburt, sondern überhaupt bei allen Erkrankungen von Menschen und Tieren. Aber auch, wenn Verdacht auf Hexerei bestand, wandte man sich an diese Spezialisten, um sich Gegenmittel zu verschaffen - und Hinweise auf die Täter! Spätestens mit dieser Funktion als ‚Hexenbanner' begaben sich die volkstümlichen Heiler selbst auf das gefährliche Feld magischer Rituale und setzten sich entsprechender Verdächtigungen bei den Obrigkeiten aus. Doch der Versuch ihrer Unterdrückung misslang, eben weil sich die Volksmagier einer ausgeprägten Wertschätzung seitens der Bevölkerung erfreuten.
Zusammenfassung
Romantisierung und Mystifizierung der 'Hexen' oder ihres Geheimwissens, Dämonisierung ihrer Verfolger, Transfer eines antiquierten Täterbildes in die Moderne und Rückprojektion gegenwartsbezogener Diskurse auf historische Verhältnisse: auf dieser Ebene stellen sich die Bremer Autoren nur als jüngste Vertreter einer pseudowissenschaftlichen Ahnengalerie dar, deren Mitglieder sich allesamt von Wunschdenken und Vorurteilen antreiben ließen. Wer sich davon freimachen kann, den führen die archivalischen Quellen mit einer bisweilen erstaunlichen Plastizität durchaus in die Nähe der historischen Wirklichkeit.
Literatur
Bauer, Dieter R.; Lorenz, Sönke (Hg.): Himmlers Hexenkartothek. Das Interesse des Nationalsozialismus an der Hexenverfolgung, Bielefeld 1999.
Behringer, Wolfgang: Die Vernunft der Magie. Hexenverfolgung als Thema der europäischen Geschichte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.8.1987, S. 25.
Behringer, Wolfgang: Die Drohung des Schadenszaubers. Von den Regeln wissenschaftlichen Arbeitens. Eine Antwort auf Heinsohn und Steiger, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.10.1987, S. 37.
Behringer, Wolfgang: Geschichte der Hexenforschung, in: Sönke Lorenz (Hg.): Hexen und Hexenverfolgung im deutschen Südwesten. Katalog einer Ausstellung, Aufsatzband, Karlsruhe 1994, S. 93-146.
Briggs, Robin Women as Victims? Witches, Judges and the Community. In: French History 37 (1991), S. 438-450.
Hachmeister, Lutz: Der Gegnerforscher. Die Karriere des SS-Führers Franz Alfred Six, München 1996.
Heinsohn, Gunnar; Steiger, Otto: Die Vernichtung der weisen Frauen. Hexenverfolgung, Kinderwelten, Bevölkerungswissenschaft, Menschenproduktion. Beiträge zur Theorie und Geschichte von Bevölkerung und Kindheit. Mit einem ausführlichen, aktualisierten und nochmals erweiterten Nachwort sowie einem Register zur Neuausgabe, 3. erw. Ausgabe, Müchen 1985.
Heinsohn, Gunnar; Steiger, Otto: [Erwiderung auf die Rezension von Gerd Schwerhoff], in: Geschichtsdidaktik 11 (1986) , S. 420-422.
Jerouschek, Günther: Des Rätsels Lösung? Zur Deutung de Hexenprozesse als staatsterroristische Bevölkerungspolitik, in: Kritische Justiz 19 (1986), S. 443-459.
Jütte, Robert: Die Persistenz des Verhütungswissens in der Volkskultur. Sozial- und medizinhistorische Anmerkungen zur These von der ‚Vernichtung der weisen Frauen', in: Medizinhistorisches Journal 24 (1989), S. 214-231.
Kunisch, H.: Art. "Weise" (adj.) und "Weisemutter, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 14. Bd., 1. Abteilung, 1. Teil, bearb. von Alfred Götze und der Arbeitsstelle des Deutschen Wörterbuches zu Berlin, Leipzig 1955, Sp. 1019 f. u. Sp. 1078.
Leibrock-Plehn, Larissa: Hexenkräuter oder Arznei. Die Abtreibungsmittel im 16. und 17. Jahrhundert, Stuttgart 1992.
Rummel, Walter: Weise' Frauen und ‚weise' Männer im Kampf gegen Hexerei. Die Widerlegung einer modernen Fabel. In: Christof Dipper, Lutz Klinkhammer und Alexander Nützenadel (Hg.): Europäische Sozialgeschichte. Festschrift für Wolfgang Schieder, Berlin 2000, S. 353-376.
Schormann, Gerhard: [Rezension von Heinsohn u. Steiger, Die Vernichtung der weisen Frauen], in: Der Staat25 (1986), S. 635-636.
Schwerhoff, Gerd: [Rezension von Heinsohn u. Steiger, Die Vernichtung der weisen Frauen], in: Geschichtsdidaktik 11 (1986), S. 95-97.
Schwerhoff, Gerd: Erwiderung auf die Antikritik von G. Heinsohn/ Otto Steiger, in: Geschichtsdidaktik 11 (1986), S. 422-423.
Schwerhoff, Gerd: Hexerei, Geschlecht und Regionalgeschichte. Überlegungen zur Erklärung des scheinbar Selbstverständlichen, in: Gisela Wilbertz, Gerd Schwerhoff , Jürgen Scheffler (Hg.): Hexenverfolgung und Regionalgeschichte. Die Grafschaft Lippe im Vergleich, Bielefeld 1994, S. 325-353.
Diskussionsverlauf:
- Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 14:35 (43)
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 02.02.2004 09:28
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 02.02.2004 09:11
- Re: PS: Echte Satanisten sind extreme egoistische Materialisten ~ - 02.02.2004 09:16
- ä bissle Geschichte ~ - 01.02.2004 09:23
- Re: ä bissle Geschichte ~ - 01.02.2004 13:06
- Re: ä bissle Erklärung ~ - 01.02.2004 15:12
- Re: ä bissle Geschichte ~ - 01.02.2004 14:09
- Was ich noch vergessen hab.... ~ - 01.02.2004 10:02
- Re: ä bissle Geschichte ~ - 01.02.2004 13:06
- gibts das? ~ - 31.01.2004 22:36
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 18:52
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 19:09
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 23:04
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 00:48
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 07:47
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 13:12
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 02.02.2004 09:19
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 12:30
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 14:09
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 15:17
- Noch ein link ~ - 01.02.2004 15:22
- Re: Noch ein link ~ - 02.02.2004 00:52
- Re: Noch ein link ~ - 02.02.2004 12:16
- Re: Noch ein link ~ - 02.02.2004 19:09
- Re: Noch ein link ~ - 02.02.2004 10:08
- Re: Noch ein link ~ - 02.02.2004 12:16
- Re: Noch ein link ~ - 02.02.2004 00:52
- Noch ein link ~ - 01.02.2004 15:22
- Cerunnos oder Satyr ~ - 01.02.2004 14:50
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 15:17
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 14:09
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 13:12
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 07:47
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 01.02.2004 00:48
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 20:42
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 19:15
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 23:04
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 19:09
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 18:38
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 19:17
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 19:21
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 19:17
- *lach* ~ - 31.01.2004 18:13
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 17:55
- Re: Anti-Satanistische Hexen gibts das? ~ - 31.01.2004 16:39
- Re: Vorurteil X: Satanistische Hexen! ~ - 31.01.2004 15:12
- aehm....wollen wir mal ein wenig unterteilen? ~ - 31.01.2004 22:14
- Re: aehm....wollen wir mal ein wenig unterteilen? ~ - 01.02.2004 01:03
- Re: Oh ... ein neues Vorurteil => Nr. 13 ~ - 31.01.2004 23:52
- falsch gelesen? ~ - 01.02.2004 00:29
- Re: schreib genauer ~ - 01.02.2004 14:28
- Re: falsch gelesen? ~ - 01.02.2004 01:04
- falsch gelesen? ~ - 01.02.2004 00:29
- Re: Vorurteil X: Satanistische Hexen! ~ - 31.01.2004 19:24
- aehm....wollen wir mal ein wenig unterteilen? ~ - 31.01.2004 22:14