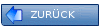Beiträge: 0
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
27 gesamt
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
27 gesamt
Hauptforum
Paranormal Deutschland
e.V.
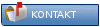
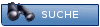
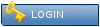
Hauptforum Heilerforum Hexenforum Jenseitsforum Literaturforum OBE-Forum Traumforum Wissensforum Nexus Vereinsforum ParaWiki Chat
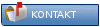
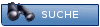
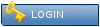
(BETA) Links zu Beiträgen, Artikeln, Ressorts und Webseiten, die zu diesem Beitrag passen könnten (Alle bisher vermerkten Stichwörter und URLs):
Bewusstsein: Geheimnis des BewuÃtseins Bewusstsein: Bewusstsein&Materie (wiki) Handlesen: Die Kunst des Handlesens (*) Test: Regeln für Experimente (wiki)
re[5]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen
> > > Dalua
> > >
> > > Die Seele ist nur eine Illusion
> > -
> >
> > Das ist eine interessante Aussage. Die Seele ist eine Vorstellung. Was auch interessant ist, wer sagt das?
> >
>
> Mir wurde kürzlich weisgemacht, das Ego sei eine Illusion des Kollektivs - auch eine nette Variante, oder? ;-)
---
Kurz zur Begriffsverständigung
Kollektiv?
Der Begriff Kollektiv (lat: colligere zusammensuchen, zusammenlesen) bezeichnet eine Lebens- oder Arbeitsgemeinschaft, in der die Aufgaben gemeinschaftlich angegangen werden; seltener ist eine 'ganze Gesellschaft'. In anarchistischen, kommunistischen und autonomen Vorstellungen von einer herrschaftsfreien und gesamtverantwortlichen Gemeinschaften ist Kollektivität eine angestrebter politischer Prozess. Kollektivität meint hier keine Einengung der Individualität. Das Verständnis von gemeinschaftlicher Verantwortung schließt auch die Verantwortung für den Schutz der Individualität ein. In der Kommunebewegung spielt der Kollektivgedanke eine primäre Rolle.
Illusion?
Im Begriff Illusion steckt das ältere und heute ungebräuchliche Zeitwort „illudieren“ (von lat.: ludere spielen): sein Spiel mit jemandem treiben, ihn verspotten, ein Gesetz umgehen.
Eine Illusion bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch eine mit technischen Mitteln herbeigeführte Sinnestäuschung. Eine Vorstellung geben, Schauspielern, Masken tragen. Täuschungen führen zu Enttäuschung.
Die große Illusion
Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Sagt die Gehirnforschung.
von Volker Lange
Eine Fahrt auf der Autobahn. Drei Stunden liegen hinter uns, vier noch vor uns. Zeit für eine Pause, denken wir, als wir das Schild der Raststätte sehen. Andererseits könnte die Zeit knapp werden. Aber was nützt es, jetzt unkonzentriert weiterzufahren, eventuell sogar einen Unfall zu verursachen, zumindest jedoch hundemüde anzukommen? Also anhalten oder weiterfahren? Die Raststätte kommt näher. Bewußt beschließen wir jetzt, doch einen Kaffee trinken zu gehen. Wir lenken den Wagen auf den Parkplatz.
Eine ganz alltägliche Geschichte. Aber Gehirnforscher würden sie anders erzählen. Aus wissenschaftlicher Sicht würde die Situation etwa folgendermaßen ablaufen. Tief im Unterbewußten meldet sich die Müdigkeit. Das Gehirn registriert unbewußt das Schild der Raststätte. Aus Erfahrung weiß es, daß man sich hier erholen kann. Es signalisiert dem Körper, sich auf das Abbiegen vorzubereiten.
Plötzlich meldet sich ein anderes Bündel Neuronen. Es hat unbewußt den Zeitplan des Tages überschlagen. Wenn wir zu spät kommen, wendet diese Instanz ein, gibt es Ärger. Auch sie weiß das aus Erfahrung. Das Gehirn wägt unbewußt ab. Was ist unangenehmer? Müdigkeit oder der zu erwartende Ärger? Das Gehirn entschließt sich und gibt den Befehl an die Gliedmaßen zum Bremsen. Und all das geschieht, ohne daß unser Bewußtsein etwas davon merkt. Erst Sekundenbruchteile später wird es über die Entscheidung informiert.
Nicht gerade plausibel, diese zweite Version, oder? Das würde doch heißen, daß unser Gehirn autonom handelt und plant, und unser Bewußtsein gerade noch so etwas wie ein Sahnehäubchen ist, das oben auf schwimmt: Hübsch anzusehen, aber eigentlich nutzlos? Widerspricht das nicht all unseren subjektiven Erfahrungen? Wo bleibt da der freie Wille?
"Das Gefühl", so antwortet Prof. Gerhard Roth, Gehirnforscher an der Uni Bremen und Rektor des Hanse-Wissenschaftskollegs auf solche Fragen nur trocken, "daß ich als bewußt handelndes Subjekt der Herr meiner Handlungen bin, ist eine Illusion. Das Gehirn hat entschieden, bevor ich das Gefühl habe, daß ich das will, was ich gleich tun werde."
Daß dem so ist, schwante zum ersten Mal zwei deutschen Wissenschaftlern im Jahre 1965. Der Neurophysiologe Hans H. Kornhuber und sein Mitarbeiter Lüder Deecke wollten mit Hilfe der Elektronenenzephalographie, kurz EEG genannt, den Zusammenhang zwischen willkürlichen Hand- und Fußbewegungen und den Wellenmustern im Gehirn erforschen. Dabei stellten sie ein seltsames Phänomen fest: Bewegte die Versuchsperson die Hand oder den Fuß, ließ sich an den Kurven des EEG bereits etwa eine Sekunde vor der Handlung ein Wellenmuster nachweisen. Gewissermaßen eine Vorwarnung, die Kornhuber und Deecke "Bereitschaftspotential" nannten.
Eine Sekunde, das war eine erstaunlich lange Zeit. Und als der Amerikaner Benjamin Libet, Neurophysiologe an der University of California in San Francisco die Studien aus Deutschland in die Hand bekam, drängte sich ihm förmlich eine Frage auf: "Ich dachte viele Jahre darüber nach", so Libet später, "wie diese knappe Sekunde vom Bewußtsein wahrgenommen wird. Oder anders ausgedrückt: Wieviel Zeit vergeht zwischen der bewußten Entscheidung des Gehirns und der eigentlichen Handlung."
Ganz sicher keine Sekunde. Wenn man die Hand ausstreckt, bewußt den Fuß bewegt um gegen die Wand zu treten, dann wartet man nicht so lange. Wäre es so, wir würden uns im Zeitlupentempo durch die Welt bewegen. Die einzige Erklärung war, daß das Bereitschaftspotential für eine Handlung im Gehirn bereits eingesetzt hat, bevor wir uns bewußt zu einer Handlung entschließen. Ein beunruhigender Gedanke, - denn zuende gedacht würde er in Frage stellen, daß wir Herr unserer Sinne und unserer Handlungen sind, - daß der freie Wille, auf den wir so stolz sind, reine Makulatur ist.
Libet wollte und mußte diese Gedanken in einem wissenschaftlichen Experiment überprüfen. Im Jahre 1979 führte er mit fünf Studenten seine erste Testreihe durch. Er forderte seine Versuchspersonen auf, eine einfache Handbewegung vorzunehmen, wenn sie Lust darauf verspürten. Mit diversen Apparaten maß er dabei einerseits die elektrischen Aktivitäten in Hand und Gehirn, andererseits ermögliche eine spezielle Uhr den Studenten, sich äußerst präzise den Zeitpunkt ihrer Entscheidung zu merken.
Das Ergebnis: Unsere Handlungen setzen unbewußt sein. Das Bewußtsein, etwa den Finger krümmen zu wollen, setzte bei den Studenten fast eine halbe Sekunde nach dem Moment ein, in dem das Gehirn bereits seine Vorbereitungen zur Handlung begonnen hatte. Die Schlußfolgerung: Nicht das Bewußtsein, sondern unbewußte Prozesse stehen am Anfang.
Libets Experimente lösten eine stürmische Debatte in der Gehirnforschung aus. War bei seinen Experimenten alles mit rechten Dingen zugegangen? Waren seine Messungen vielleicht ungenau? Verschiedene Wissenschaftler, auch solche, die Libets Messungen anzweifelten, wiederholten seine Versuche. Sie kamen alle zu den selben Ergebnissen.
Trotzdem blieb eine gravierende Frage offen: Warum merken wir nichts von dieser Verzögerung. Warum glauben wir, daß Entschluß und Handlung unmittelbar aufeinander folgen? Auch dafür hatte Libet eine These parat. Bei Versuchen, die er mit Patienten (mit deren Einwilligung!) durchgeführt hatte, denen für eine Gehirnoperation die Schädeldecke geöffnet worden war, war er auf eine seltsames Phänomen gestoßen: Das Gehirn betrügt sich selbst. Es tut alles, um die Tatsache vor sich selbst zu verbergen, daß das Bewußtsein verzögert einsetzt und projiziert das bewußte Erleben etwa eine halbe Sekunde zurück.
Unglaublich? Nicht, wenn man sich vor Augen führt, was geschieht, wenn man sich schneidet oder an einer heißen Herdplatte verbrennt. Man zieht blitzschnell die Hand zurück, mit einer gewissen Verzögerung denkt und ruft man "Aua" , spürt dann erst den Schmerz und hat doch das Gefühl, daß das Verbrennen, der Schmerz, das Zurückziehen der Hand und der Schmerzensschrei im gleichen Augenblick stattgefunden haben.
Die aufsehenerregenden Versuche des Benjamin Libet, so der Bremer Hirnforscher Roth, stimmen außerdem mit den Befunden überein, die Neurologen und Mediziner inzwischen auf anderen Gebieten der Hirnforschung gewonnen haben, unter anderem bei der Untersuchung von Parkinsonpatienten. Das Gefühl eines willentlichen Entschlusses ist also nicht die Ursache für eine Handlung, es ist eine Begleiterscheinung, die auftritt, nachdem das Gehirn seinen Entscheidungsprozeß bereits begonnen hat.
Die Entscheidungskriterien bezieht das Gehirn dabei, zumindest deuten alle bisherigen Untersuchungen darauf hin, aus dem sogenannten limbischen System. Das limbische System ist der Ort der unbewußten Erfahrungen und der Gefühle. Das Gehirn als System entscheidet also autonom, es braucht unseren freien Willen nicht.
"Das finden natürlich viele Leute schockierend", so Roth, "aber es ist auch gleichzeitig beruhigend: Der Entscheidung meines Gehirns geht nämlich ein großer Entscheidungsprozeß voraus, unbewußt, der alle Erfahrungen, die ich seit dem Mutterleib gemacht habe, in Betracht zieht und bewertet." Im Lichte seiner gesamten Erfahrung wägt das Gehirn also blitzschnell ab, welche Handlungsalternative dem Organismus nützt und welche im schadet. "Wir tun nicht, was wir wollen", so der Dr. Wolfgang Prinz, Direktor am Max - Planck - Institut für Psychologische Forschung in München, "sondern wir wollen, was wir tun!"
Zertrümmert so die Hirnforschung eine weitere Illusion der Menschheit? In der Vergangenheit mußten wir lernen, daß die Erde weder der Mittelpunkt der Welt, noch der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Wird uns jetzt noch der Glaube an uns selbst als bewußt handelndes und gestaltendes Subjekt genommen? Sind wir nichts anderes als seelenlose Roboter?
Benjamin Libet gestand dem Bewußtsein zumindest noch ein Vetorecht zu. Nachdem unser Gehirn eine Handlung vorbereite, könnten wir diese Handlung durch Planen, Abwägen und bewußtes Eingreifen noch abbrechen oder steuern. Der Bremer Forscher Gerhard Roth glaubt nicht daran. Neuere Forschungen deuteten darauf hin, so der Wissenschaftler, daß jene Regionen, die für dieses Planen und Abwägen zuständig sind, ebenfalls unter Kontrolle der unbewußt arbeitenden Hirnzentren stehen. Willensfreiheit, so sein Fazit, ist deshalb eine Illusion. (1999)
Was ist nun das Ego?
Damit kommen wir zu einem besseren Überblick zur o.g. Aussage:
Diskussionsverlauf:
- Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Eris * 11.03.2006 13:31 (31)
- Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ - 12.03.2006 01:58
- re: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Eris * 12.03.2006 09:02
- Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ - 13.03.2006 11:18
- re[2]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Dalua * 12.03.2006 09:20
- re[3]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Sabine * 12.03.2006 10:41
- re[4]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Elgrin * 12.03.2006 21:09
- re[5]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Sabine * 13.03.2006 08:19
- re[6]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Elgrin * 13.03.2006 16:20
- @ Elgrin, Ego, Freiheit, Klosteranlagen, Kriegsgräben ~ Sabine * 14.03.2006 09:45
- re: @ Elgrin, Ego, Freiheit, Klosteranlagen, Kriegsgräben ~ Elgrin * 14.03.2006 15:55
- re[2]: @ Elgrin, Ego, Freiheit, Klosteranlagen, Kriegsgräben ~ Sabine * 14.03.2006 19:21
- re: @ Elgrin, Ego, Freiheit, Klosteranlagen, Kriegsgräben ~ Elgrin * 14.03.2006 15:55
- @ Elgrin, Ego, Freiheit, Klosteranlagen, Kriegsgräben ~ Sabine * 14.03.2006 09:45
- re[6]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Füchsin * 13.03.2006 09:17
- re[7]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Sabine * 13.03.2006 09:59
- Nahtoderfahrungen ~ Füchsin * 13.03.2006 13:41
- re[7]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Sabine * 13.03.2006 09:59
- re[6]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Elgrin * 13.03.2006 16:20
- re[5]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Sabine * 13.03.2006 08:19
- re[4]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Dalua * 12.03.2006 10:48
- re[5]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Füchsin * 13.03.2006 09:20
- re[5]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Sabine * 12.03.2006 11:11
- re[4]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Elgrin * 12.03.2006 21:09
- re[3]: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Sabine * 12.03.2006 10:41
- re: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Dalua * 12.03.2006 08:18
- Fragen ~ - 12.03.2006 03:36
- Fragen ~ - 13.03.2006 11:08
- re: weitere Fragen ~ - 14.03.2006 03:18
- weitere Fragen ~ - 15.03.2006 01:05
- re[2]: weitere Fragen ~ Füchsin * 14.03.2006 08:44
- re[3]: Schattenarbeit ~ - 14.03.2006 14:55
- re[4]: Schattenarbeit ~ Füchsin * 14.03.2006 15:57
- re[5]: Schattenarbeit ~ - 15.03.2006 03:23
- re[4]: Schattenarbeit ~ Füchsin * 14.03.2006 15:57
- re[3]: Schattenarbeit ~ - 14.03.2006 14:55
- Astral-/Traum-Ebenen ~ Elgrin * 13.03.2006 17:01
- re: Fragen ~ Füchsin * 13.03.2006 13:33
- re[2]: Fragen ~ Elgrin * 13.03.2006 16:41
- Begriff-Salat und variierende Fachausdrücke ~ Füchsin * 14.03.2006 09:07
- re: Begriff-Salat und variierende Fachausdrücke ~ Elgrin * 14.03.2006 16:06
- Begriff-Salat und variierende Fachausdrücke ~ Füchsin * 14.03.2006 09:07
- re[2]: Fragen ~ Elgrin * 13.03.2006 16:41
- re: weitere Fragen ~ - 14.03.2006 03:18
- Fragen ~ - 13.03.2006 11:08
- re: Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ Eris * 12.03.2006 09:02
- Verletzungen durch Doppel und Imaginationen ~ - 12.03.2006 01:58